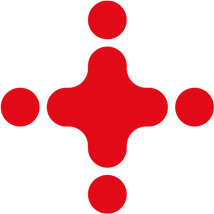Ombeni Ngonyani „ACHTUNG!“ Dieses Wort hörte Ombeni Ngonyani als Kind in Daressalam immer wieder einmal, wenn sie mit ihrem Großvater Lyander zusammen war. Es klang hart und fremd in ihren Ohren. Was es bedeutet, sollte sie erst später lernen. Und wie sehr es die ganze, weit verstreute Familie prägt, das weiß sie heute.
Ombeni Ngonyani „ACHTUNG!“ Dieses Wort hörte Ombeni Ngonyani als Kind in Daressalam immer wieder einmal, wenn sie mit ihrem Großvater Lyander zusammen war. Es klang hart und fremd in ihren Ohren. Was es bedeutet, sollte sie erst später lernen. Und wie sehr es die ganze, weit verstreute Familie prägt, das weiß sie heute.
Doch zunächst geht es um einen Schlüssel. Denn wer sich im sogenannten Tansania-Park auf dem Gelände der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne in Hamburg-Jenfeld auf die Suche nach dem Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmal 1914-1918 machen möchte, steht vor verschlossenen Toren. Das Internet liefert nur spärliche Informationen, Telefonnummern führen ins Leere. Stunden der Recherche sind nötig, bis der Schlüssel bei einem ortsansässigen Verein ausfindig gemacht ist.
Ehrendenkmal für koloniale Schutztruppen
Dann stehen sie da, die sogenannten Askari-Reliefe, versteckt hinter Hecken. Vereinzelt hat sich Löwenzahn auf den übergroßen Terrakotta-Figuren breitgemacht: Ein deutscher Unteroffizier führt vier einheimische Soldaten der „Schutztruppe“ an. Gegenüber spiegelt sich die Hierarchie mit vier Trägern wider. Das Werk aus der Zeit des Nationalsozialismus huldigt der Kolonialzeit Deutschlands. In der Nachbarschaft: Ein Ehrenmal für diese kolonialen Schutztruppen und das denkmalgeschützte Ensemble aus von der Wehrmacht errichteten Gebäuden. Eines ist Hermann von Wissmann gewidmet, der als Befehlshaber der ersten Kolonialtruppen in „Deutsch-Ostafrika“ viele Menschen ermorden ließ, um Überlebende gefügig zu machen. Ein anderes Haus ist benannt nach Lothar von Trotha, der im damaligen „Deutsch-Südwestafrika“ die Vernichtung der Herero und Nama, die sich ihr Land nicht nehmen lassen wollten, befahl und anführte. Heute gehen unter seinem steinernen Konterfei Studenten ein und aus.
Im Wettlauf um Macht, Einfluss und wirtschaftliche Vorherrschaft, der durch die Industrialisierung vorangetrieben wurde, nahm das Deutsche Kaiserreich in den Jahren zwischen 1880 und 1914 sogenannte Schutzgebiete in Afrika und im Pazifik an sich. Lange nachdem die ersten christlichen Missionare diesen Weg bereitet hatten. Unter diesen Gebieten waren Regionen entlang der afrikanischen Westküste, das Gebiet um Namibia (als „Deutsch-Südwestafrika“) und „Deutsch-Ostafrika“, das das heutige Tansania, Burundi und Ruanda sowie einen Teil von Mosambik umfasste.
Verarbeitung kolonialer Ware in Hamburg
Zeitweise war Deutschland nach England und Frankreich drittgrößte Kolonialmacht der Welt – mit Hamburg als blühender Handelsmetropole und Ort expandierender Fabriken für die Verarbeitung der vielen Rohstoffe, die dem Raubbau in den Kolonien entstammten. Europas wichtigster Standort der Gummi-Industrie fand sich damals in der Hansestadt. Ebenso das weltweit größte Zentrum der Speiseöl-Produktion. In ihrem ersten Jahrzehnt in Afrika exportierten die deutschen Kolonien rund 848.000 Kilogramm Elfenbein von Hunderttausenden erschossenen Elefanten. Der größte Teil kam über den Hamburger Hafen ins Land.
Mehr als 100 Jahre nachdem ihr Urgroßvater Suleyman und später auch ihr Großvater Lyander für die Deutschen zur Waffe greifen mussten, steht Ombeni Ngonyani, eingehüllt in ihren Wintermantel, vor dem tönernen Abbild eines Askaris und schweigt lange. „Das muss doch in die Stadt hinein“, bricht es dann aus ihr heraus. „Das ist wie eine zweite Demütigung, so versteckt hier draußen.“ Die 50-jährige Autorin, Verlagsgründerin und Umweltaktivistin lebt seit ihrem 15. Lebensjahr in Deutschland.

Kampf gegen Neokolonialismus
Als Botschafterin für die „Stiftung Lesen“ liest sie aus ihren Büchern. Lehrer und Pädagogen buchen die Referentin für globales Lernen, um über Alltagsrassismus oder das koloniale Erbe zu sprechen, denn: Ombeni Ngonyani gleicht aus, was Schule oft nicht vermag. „Seit mehr als zehn Jahren fordere ich, dass die deutsche Kolonialgeschichte kritisch in den Lehrplan ab Klasse 5 aufgenommen wird. Hier müssen wir ansetzen“, sagt sie. „Nur wenn alle Bescheid wissen, können wir das Geschehene verarbeiten. Nur dann haben wir eine Chance, neokoloniale Strukturen heute aufzubrechen und dem Rassismus die Stirn zu bieten.“
Am Mausoleum für Heinrich Carl von Schimmelmann, das als eines der klassizistischen Hauptwerke in Norddeutschland gilt, blickt Sylvaina Gerlich empor. Es steht in einem kleinen Park im Bezirk Wandsbek, wenige Gehminuten von ihrem Büro entfernt. Als Sklavenhalter und Sklavenhändler bestimmte Schimmelmann im 18. Jahrhundert weit vor dem Höhepunkt deutscher Kolonialinteressen den sogenannten atlantischen Dreieckshandel, nachdem er sich für wenig Geld Baumwoll- und Zuckerrohrplantagen in der Karibik angeeignet hatte.
Aus seinen Manufakturen exportierte Schimmelmann Waren wie Kattun und Alkohol an die afrikanische Westküste. Von dort aus ließ er Sklaven nach Amerika verschiffen, von wo seine Flotte mit neuer Baumwolle und Zuckerrohr für seine Fabriken zurückkam. Dieses System machte Schimmelmann zum reichsten Mann Europas. Dass dieser Wohlstand auf dem Leid Zehntausender Menschen gründet, ist einer Erinnerungstafel am Mausoleum einen Nebensatz wert.
 Wohlstand auf dem Leid Zehntausender: Sylvaina Gerlich vor dem Schimmelmann-Mausoleum.
Wohlstand auf dem Leid Zehntausender: Sylvaina Gerlich vor dem Schimmelmann-Mausoleum.
„Geschichte steht im Kontext ihrer Zeit“
Sylvaina Gerlich ist eine selbstbewusste Frau. Bilder in ihrem Büro erinnern an ein Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel, an ein Händeschütteln mit dem früheren Präsidenten Christian Wulff. Geboren in Ghana, aufgewachsen in England, lebt sie seit vielen Jahren in Hamburg. 2008 gründete sie das Interkulturelle Migranten Integrations Center (IMIC e.V.) und ist Mitglied im Integrationsbeirat der Stadt. Jedes Jahr organisiert sie den „African Day“, an dem afrikaverbundene Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammenkommen.
„Wir sind als Black Community stark – das müssen wir zeigen und diese Stärke besonders an die junge Generation weitergeben“, sagt sie. „Aber dazu gehört auch, nichts weglassen zu müssen. Geschichte steht immer im Kontext ihrer Zeit. Dem müssen wir uns stellen.“ Darum wünscht sich Sylvaina Gerlich auch, die vielen Straßen, die in Hamburg nach Personen oder Orten im Zusammenhang der deutschen Kolonialpolitik benannt sind, nicht einfach umzuwidmen. „Besser wäre es doch, mit einem Schild auf die Geschichte dahinter aufmerksam zu machen.“
„Hamburgs Straßen bleiben nach Verbrechern benannt“
Für Millicent Adjei Millicent Adjei , seit vielen Jahren engagiert im zivilgesellschaftlichen Bündnis Arbeitskreis Hamburg Postkolonial, ist das einer von vielen schmerzhaften Punkten im Dekolonisierungsprozess der Stadt. Die Bilanz ist deutlich: Bis heute ist es nicht gelungen, auch nur eine der weit mehr als 100 kolonial belasteten Straßen in Hamburg umzuwidmen. Und das, obwohl sich die Stadt seit 2014 zur Aufarbeitung seiner Kolonialvergangenheit verpflichtet und 2019 einen Beirat zur Dekolonisierung berufen hat. „Wo also stehen wir und wie ernst kann ich dieses Vorhaben einer Dekolonisierung nehmen, wenn die Vereinten Nationen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eindeutig definieren, aber Hamburgs Straßen nach Verbrechern benannt bleiben“, beklagt die Sozialökonomin, die in verschiedene Initiativen der Black Community eingebunden ist.
Millicent Adjei , seit vielen Jahren engagiert im zivilgesellschaftlichen Bündnis Arbeitskreis Hamburg Postkolonial, ist das einer von vielen schmerzhaften Punkten im Dekolonisierungsprozess der Stadt. Die Bilanz ist deutlich: Bis heute ist es nicht gelungen, auch nur eine der weit mehr als 100 kolonial belasteten Straßen in Hamburg umzuwidmen. Und das, obwohl sich die Stadt seit 2014 zur Aufarbeitung seiner Kolonialvergangenheit verpflichtet und 2019 einen Beirat zur Dekolonisierung berufen hat. „Wo also stehen wir und wie ernst kann ich dieses Vorhaben einer Dekolonisierung nehmen, wenn die Vereinten Nationen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eindeutig definieren, aber Hamburgs Straßen nach Verbrechern benannt bleiben“, beklagt die Sozialökonomin, die in verschiedene Initiativen der Black Community eingebunden ist.
So ernst, dass die Antwort des Pressesprechers der Behörde für Kultur und Medien der Stadt an missio beinahe zwei DIN A4-Seiten füllt. Man entwickele zurzeit ein dekolonisierendes Erinnerungskonzept, das eine Strategie für die Aufarbeitung der Geschichte und ihrer Folgen für Hamburg darlegen solle. Ein erstes Eckpunktepapier liege vor. Mit im Boot die Expertinnen und Experten der Schwarzen und der People of Color Communities. „Hamburg geht das Thema aktiv an“, betont Enno Isermann. Gebäude, Denkmäler und Objekte mit kolonialen Bezügen sollen dokumentiert und angemessene Formen des dekolonisierenden Erinnerns entwickelt werden.
Wie umgehen mit Denkmälern?
Bis dahin befeuert die rund zehn Millionen teure Sanierung des umstrittenen weltgrößten Bismarck-Monuments im Zentrum der Stadt die Debatte weiter. Kopf ab,schräg stellen, eine kritische Ausstellung für den Sockel? Ideen und Forderungen kursieren in den Medien. Hannimari Jokinen vom Arbeitskreis Hamburg Postkolonial beschäftigt sich seit zwei Jahrzehnten mit dem postkolonialen Erbe der Stadt. Der Vorschlag der Künstlerin: Die Denkmale zu erhalten und schrittweise so zu dekonstruieren, bis sie zu ihren eigenen Gegendenkmalen werden. In einem öffentlichen „Park Postkolonial“ könnten diese zusammengeführt werden, um dann Kunstschaffende aus den ehemals kolonisierten Ländern und aus der Diaspora einzuladen, um diese in einem fortwährenden Prozess zu transformieren, neue An- und Einsichten zu schaffen.
Doch noch lagert er ein, zunächst für einige Jahre in der Sternwarte, dann im Hafen: der bronzene Hans Dominik, Schutztruppenoffizier mit dem Beinamen „Schreckensherrscher von Kamerun“. In den späten 1960er Jahren stießen Studenten ihn vom Sockel. Für die aktuelle Ausstellung „Grenzenlos – Kolonialismus, Industrie und Widerstand“ wurde das zentnerschwere Denkmal nun wieder gehoben. Dominik vertrieb um 1900 die Menschen in Kamerun aus ihren Dörfern und machte sie zu Zwangsarbeitern auf den Plantagen. In seinem Buch „Branntwein, Bibeln und Bananen“ beschreibt Autor Heiko Möhle, wie er sich „die Köpfe seiner Gegner in Säcken zu Füßen legen“ und „kleine Kinder in einen reißenden Fluss werfen“ ließ.
Hamburg am Beginn der Auseinandersetzung
 In die Kritik geraten: Reichskanzler Otto von Bismarck.Im Museum der Arbeit – konsequenterweise in den Gebäuden, in denen früher eine Gummifabrik Kautschuk aus Übersee verarbeitete – liegt er nun auf dem Rücken. Über ihm an der Wand erheben sich die illustrierten Abbilder mutiger Frauen und Männer, die sich gegen Ungerechtigkeit und Rassismus erhoben haben. Erzählt wird auch von Widerstand und Sabotage an kolonisierten Orten.
In die Kritik geraten: Reichskanzler Otto von Bismarck.Im Museum der Arbeit – konsequenterweise in den Gebäuden, in denen früher eine Gummifabrik Kautschuk aus Übersee verarbeitete – liegt er nun auf dem Rücken. Über ihm an der Wand erheben sich die illustrierten Abbilder mutiger Frauen und Männer, die sich gegen Ungerechtigkeit und Rassismus erhoben haben. Erzählt wird auch von Widerstand und Sabotage an kolonisierten Orten.
„Hamburg steht am Beginn der Auseinandersetzung“, sagt Christopher Nixon, der die Ausstellung zusammen mit Sandra Schürmann kuratiert hat. Diese bescheinigt vielen Hamburgern bis heute einen „neutralen wenn nicht gar positiven Blick“, sei doch die koloniale Vergangenheit eng mit dem Wohlstand der Stadt verwoben. Diesen Blick will die Ausstellung verwirren: Dekonstruktion statt exotische Anleihen. Fotos, die koloniale Gewalt wie zum Beispiel Hinrichtungen zeigen, bleiben bis auf die Untertitel geschwärzt. Erlittene Gewalt soll nicht reproduziert werden. Sandra Schürmann: „Wir zeigen, dass die koloniale Industrie ein System war. Rohstoffe, Hersteller, Produkte und die koloniale Ausbeutung waren eng miteinander verwoben, geprägt von rassistischen Stereotypen.“
Ein Symbol für Ausbeutung
Bis heute machen deutsche Firmen mit Übersee-Vergangenheit Geschäfte in Afrika. Zum Beispiel das Hamburger Familienunternehmen C. Woermann GmbH & Co. mit Niederlassungen entlang der afrikanischen Westküste. Unter anderem vertreibt C. Woermann Forst- und landwirtschaftliche Maschinen, Stromaggregate, Werkzeuge oder Fahrzeugteile.
„Mit technischem Know-how in Afrika zuhause. Seit 1837“ lautet der Slogan auf der Website. Damals legte Carl Woermann den Grundstein, auf dem sein Sohn Adolph Woermann als Besitzer der ersten Afrika-Dampfschiffslinie und mit dem Tausch von Schnaps oder Waffen gegen Palmöl und Kautschuk zu einem der reichsten Hamburger werden sollte. Wie in einer Ausgabe des Magazins „Der Spiegel“ zu lesen ist, war Woermann 1884 eng in die Verträge für das „Schutzgebiet Kamerun“ einbezogen. Und er saß bei der sogenannten Kongokonferenz mit am Tisch, bei der die Großmächte Afrika unter sich aufteilten und willkürlich Grenzen zogen, die bis heute Konflikte nach sich ziehen. Heute gilt das denkmalgeschützte „Afrikahaus“ in der Altstadt, Firmensitz von C. Woermann, vielen als exotische Sehenswürdigkeit. Das Treppenhaus zieren Erinnerungsfotos und eine Replik der Frühstückskarte eines der Liniendampfer nach Westafrika. Für postkolonial Engagierte ist das Afrikahaus ein Symbol für Ausbeutung.
Zugang zu historischen Dokumenten
„Unserer Ansicht räumen wir der Geschichte einen gebührenden Platz ein“, erklärt Geschäftsführer Rasmus Woermann, Ur-Ur-Urenkel des Firmengründers, in einer Mail an missio. An der historischen Aufarbeitung beteilige man sich aktiv und auf unterschiedliche Weise: Historikern von verschiedenen Universitäten habe man Zugang zu den wenigen verbliebenen historischen Dokumenten gewährt. „Ich hege die Hoffnung, dass mit Organisationen, die dazu willens sind, in Zukunft ein engerer Austausch möglich ist.“
Ist das postkoloniale Zeitalter da? Ombeni Ngonyani steht vor dem Afrikahaus. Sie weiß, der Weg ist noch lang. Ihren Großvater, der für die Deutschen kämpfte und später ein bekannter Bandleader und Komponist in Tansania wurde, hat sie in Gedanken oft bei sich. Seine Erfahrungen prägen sie bis heute mehr als sie möchte. „Meine Schuhe müssen immer sauber und poliert sein, sonst kann ich das Haus nicht verlassen. Das hat er mir beigebracht.“
















 Als „alles andere als eindeutig“ bezeichnet der Historiker Wolfgang Reinhard die Rolle der Missionare in der Kolonialgeschichte. In seinem Beitrag „Der Missionar“ in „Kein Platz an der Sonne“ (Hrsg. Jürgen Zimmerer) stellt er jedoch klar, dass man diese (mehrheitlich) Männer und Frauen nicht pauschal als „Agenten des Kolonialimperialismus“ einordnen könne. Weit mehr Missionare als angenommen hätten bewusst Distanz zu den kolonialen Instanzen gehalten – auch wenn sie oft nicht ohne deren Schutz ausgekommen oder politisch instrumentalisiert worden seien. Dass Missionare ihren Anteil an der kulturellen Europäisierung anderer Länder haben, ist unstrittig.
Als „alles andere als eindeutig“ bezeichnet der Historiker Wolfgang Reinhard die Rolle der Missionare in der Kolonialgeschichte. In seinem Beitrag „Der Missionar“ in „Kein Platz an der Sonne“ (Hrsg. Jürgen Zimmerer) stellt er jedoch klar, dass man diese (mehrheitlich) Männer und Frauen nicht pauschal als „Agenten des Kolonialimperialismus“ einordnen könne. Weit mehr Missionare als angenommen hätten bewusst Distanz zu den kolonialen Instanzen gehalten – auch wenn sie oft nicht ohne deren Schutz ausgekommen oder politisch instrumentalisiert worden seien. Dass Missionare ihren Anteil an der kulturellen Europäisierung anderer Länder haben, ist unstrittig.