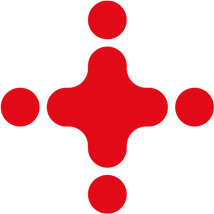Esther Mutuku hat Glasknochen, eine angeborene Erbkrankheit.ÜBERGROSS sind die Buchstaben an die rot gestrichenen Wände geschrieben: „God loves us!“ – „We are beautiful girls and we love school“. Als ob die Kinder jeden Tag daran erinnert werden sollen, dass sie von Gott geliebt werden und jedes Kind ein Geschenk ist. Auch das Projekt, um das es hier geht, heißt „Tei Wa Ngai“, übersetzt: „Geschenk Gottes“. Dass Kinder ein Segen sind, wird auch hier in Kenia kaum jemand bestreiten. Und doch kommt immer wieder vor, was ein Mädchen wie Esther Mutuku erlebt hat. Als sie zur Welt kam, merkten ihre Eltern bald: Esther ist anders. Sie lernte nicht richtig laufen. Ärzte stellten fest: Esther hat Glasknochen, eine angeborene
Esther Mutuku hat Glasknochen, eine angeborene Erbkrankheit.ÜBERGROSS sind die Buchstaben an die rot gestrichenen Wände geschrieben: „God loves us!“ – „We are beautiful girls and we love school“. Als ob die Kinder jeden Tag daran erinnert werden sollen, dass sie von Gott geliebt werden und jedes Kind ein Geschenk ist. Auch das Projekt, um das es hier geht, heißt „Tei Wa Ngai“, übersetzt: „Geschenk Gottes“. Dass Kinder ein Segen sind, wird auch hier in Kenia kaum jemand bestreiten. Und doch kommt immer wieder vor, was ein Mädchen wie Esther Mutuku erlebt hat. Als sie zur Welt kam, merkten ihre Eltern bald: Esther ist anders. Sie lernte nicht richtig laufen. Ärzte stellten fest: Esther hat Glasknochen, eine angeborene
Erbkrankheit.
„Das Kind ist verflucht!“ behaupteten einige im Dorf. „Es wird Schande über euch bringen!“ So schlimm wurden Druck und Ausgrenzung, dass Esther mit ihren Eltern aus dem Dorf weggehen musste. Sie mussten sich ein neues Zuhause suchen. In der katholischen Grundschule von Mavoloni hat Esther einen Platz gefunden. Ihre Vorgeschichte ist hier nicht so wichtig. Die Kinder sollen etwas lernen und gute Menschen werden, sagt die Lehrerin. Egal, ob sie nun eine sichtbare körperliche Beeinträchtigung haben oder nicht.
Liebevoll kümmern sich die Schulkinder umeinander. Als Esther mit ihren Krücken zur Schulbank geht, da begleitet ihre Banknachbarin sie, nimmt ihr die Gehhilfenab und hilft ihr, wenn sie sich hinsetzen möchte. Ein Junge hilft seinem Freund, der im Rollstuhl sitzt. „Es ist viel besser, wenn die Kinder gemeinsam unterrichtet werden, als wenn die Kinder mit Behinderung irgendwo alleine unter sich bleiben müssen“, sagt eine der Betreuerinnen.
Hilfe für Kinder und Eltern
Im Gebäude nebenan, genau dort, wo die großen Buchstaben an die Wand gemalt sind, hat Esther einen Platz zum Übernachten. Damit sie nicht jeden Tag den weiten Weg ins Dorf zurücklegen muss. Außerdem ist sie hier besser versorgt. Zuhause ist die Lage weiterhin ernst. Ihr Vater sitzt im Gefängnis. Er hat gestohlen und wurde gefasst. Wer wird sich jetzt um die Familie kümmern? „Ich bin jeden Tag draußen unterwegs“, sagt Schwester Pauline Ncabira. Sie ist in Kenia geboren, die Region um die Stadt Matuu ist auch ihre Heimat. Das schafft Vertrauen und öffnet ihr viele Türen. Seit den 90er-Jahren schon gibt es „Tei Wa Ngai“ – ein Programm der Ordensfrauen von „Our Lady of the Missions“, um Kindern mit Behinderung und ihren Eltern
zu helfen. Die kleine Stadt Matuu liegt etwa drei Stunden entfernt von der Weltstadt Nairobi. In der Megacity Nairobi pulsiert das moderne Afrika, hier auf dem Land leben die Menschen gerade so von dem, was ihre kleinen Felder hergeben. „Oft kommt monatelang kein Regen, und wenn er kommt, dann gibt es Überschwemmungen“, beschreibt es die Ordensfrau Pauline Ncabira.
 Unterwegs: Die Ordensschwestern Schola Matua und Pauline Ncabira versorgen Mütter und ihre Kinder.Gerade hat sie eine ihrer Verbündeten getroffen: Rosina Martin, die als sogenannte „Community Health Worker“ arbeitet. Eine überaus wertvolle Kontaktperson – sie kennt sich aus mit Krankheiten und Medikamenten, und sie lebt selbst mittendrin in der Gemeinde. Man trifft sich auf dem Markt, bei der Feldarbeitoder sonntags in der Kirche. Also, wenn in einer Familie ein Kind mit Behinderung zur Welt kommt, das Hilfe braucht, dann erfährt Rosina Martin als eine der ersten davon. Dann kann sie Hilfe organisieren.
Unterwegs: Die Ordensschwestern Schola Matua und Pauline Ncabira versorgen Mütter und ihre Kinder.Gerade hat sie eine ihrer Verbündeten getroffen: Rosina Martin, die als sogenannte „Community Health Worker“ arbeitet. Eine überaus wertvolle Kontaktperson – sie kennt sich aus mit Krankheiten und Medikamenten, und sie lebt selbst mittendrin in der Gemeinde. Man trifft sich auf dem Markt, bei der Feldarbeitoder sonntags in der Kirche. Also, wenn in einer Familie ein Kind mit Behinderung zur Welt kommt, das Hilfe braucht, dann erfährt Rosina Martin als eine der ersten davon. Dann kann sie Hilfe organisieren.
Zusammen sitzen sie jetzt im beigefarbenen Toyota, einem Fahrzeug, das wohl schon 30 Jahre alt sein dürfte, das aber die holprigen Straßen immer noch mühelos bezwingt. Schwester Pauline, ihre Mitschwester Schola Mutua und Rosina Martin wollen heute nach dem Mädchen Teresia schauen. Sie lebt nicht weit von hier“, sagt Rosina Martin, als sie aus dem Geländewagen aussteigt. Ab jetzt geht es nur noch zu Fuß voran. Allerdings ist „nicht weit“ eine etwas optimistische Angabe – immerhin gilt es, an vertrockneten Maisstauden vorbeizuwandern, ein ausgetrocknetes Flußbett zu durchqueren und dann noch einen kleinen Hügel zu erklimmen. „Da sind wir!“
Gut vernetzt auch noch im kleinsten Dorf
Teresia Mueni ist 16 Jahre alt, sie lebt bei Monica, ihrer Großmutter. Ihre Oma sagt: „Als sie einen Tag auf der Welt war, da starb ihre Mutter. Ich habe Teresia dann zu mir genommen.“ Dem Mädchen fehlte bei der Geburt ein Teil des linken Armes. „Ich wusste nicht, wie ich sie versorgen sollte“, sagt Monica, die Großmutter. Zum Glück hörte Rosina Martin bald davon, dass es in der Familie ein Mädchen gab, das ihre Hilfe brauchte. Sie informierte Schwester Pauline Ncabira, und seitdem haben sie Teresia begleitet. Vor kurzem waren sie in der Stadt mit ihr. Ein Arzt hat sie untersucht, um festzustellen, wie sich ihr Arm entwickelt. „Wir hoffen darauf, dass sie eine Prothese bekommen kann“, sagt Rosina Martin. Doch aus ihrer Erfahrung weiß sie: Das hat erst Sinn, wenn Teresia nicht mehr wächst. „Sonst muss die Prothese wieder erneuert werden. Das kostet zu viel Geld.“ Geld. Nicht die Behinderung ist oft die größte Herausforderung, sondern die Armut. Viele Menschen, besonders in den ländlichen Regionen, können sich lebenswichtige Dinge – Essen, Schule, Medikamente – schlicht nicht leisten. Und oft müssen die Familien überlegen: Reicht das Essen für alle? Schwester Pauline hat oft beobachtet, dass im Ernstfall dann zuerst die Kinder etwas zu essen bekommen, die ohne Behinderung leben. „Das behinderte Kind wird als letztes versorgt.“
 Sprechstunde: Schon am frühen Morgen wächst die Warteschlange.Teresia sitzt still da, und erzählt leise: Sie freue sich, dass sie zur Schule gehen kann. „Die anderen Kinder helfen mir“, sagt sie, sie fühle sich nicht ausgegrenzt. Und sie lernt, ihr Leben selbst zu meistern. „Ich kann jetzt meine Kleidung selber waschen“, sagt sie, der fehlende linke Arm ist da kein Hindernis.
Sprechstunde: Schon am frühen Morgen wächst die Warteschlange.Teresia sitzt still da, und erzählt leise: Sie freue sich, dass sie zur Schule gehen kann. „Die anderen Kinder helfen mir“, sagt sie, sie fühle sich nicht ausgegrenzt. Und sie lernt, ihr Leben selbst zu meistern. „Ich kann jetzt meine Kleidung selber waschen“, sagt sie, der fehlende linke Arm ist da kein Hindernis.
Das Essen reicht nicht immer für alle
Eine Weile bezahlten die Schwestern aus dem „Tei Wa Ngai“-Programm das Schulgeld für sie. Dann hätte die Großmutter dafür aufkommen sollen, so war es eigentlich vereinbart. „Aber ich habe es nicht bezahlen können“, beteuert sie. Die Folge: Teresia musste von der Schule wegbleiben, sie verlor ein ganzes Schuljahr. Die Schwestern wollen versuchen, dass sie es wieder aufholen kann – wenn auch für sie das Geld reicht, denn auch im „Tei Wa Ngai“-Programm sind sie auf fremde Hilfe angewiesen.
Und die Zahl der Bedürftigen ist hoch: „Wir wissen nicht genau warum, aber in unserer Region gibt es mehr Kinder mit Behinderung, als anderswo“, hat Schwester Pauline beobachtet. Es ist schwer, an belastbare Zahlen zu kommen, und die Gründe dafür, warum Kinder mit einer Behinderung geboren werden, können vielfältig sein. Erbkrankheiten mögen eine Ursache sein, aber auch die schlechte Versorgung der Mütter während einer Schwangerschaft. Und immer wieder ist es auch der erschreckende Mangel an Bildung, an grundlegenden Informationen. Schwester Pauline hat beobachtet, dass viele Mütter wahllos Medikamente nehmen, die ihnen auf dem Schwarzmarkt billig verkauft werden – ohne dass sie zum Beispiel wissen, ob diese Pillen während der Schwangerschaft vielleicht ihrem ungeborenen Kind schaden können.
"Wir geben unser Bestes"
 Mobil trotz Handicap - Physiotherapie kann kleine Wunder bewirken.
Mobil trotz Handicap - Physiotherapie kann kleine Wunder bewirken.
Mangelnder Zugang zu Bildung und große Armut – damit kämpfen die Menschen hier jeden Tag. Und wenn dann ein Kind zur Welt kommt, das auf eine Gehhilfe angewiesen ist, oder auf regelmäßige Medikamente, dann wird es umso schwieriger. Seit fast 30 Jahren kämpfen die Schwestern mit ihrem Programm dagegen an. Oft genügen schon vergleichsweise kleine Maßnahmen: Wenn sie etwa mit einem Physiotherapeuten zur Gesundheitsstation kommen, der sich mit körperlichen Beeinträchtigungen bei Kindern auskennt, dann ist schon frühmorgens die Warteschlange lang. „Die Arbeit ist wahrlich kein Spaziergang für uns“, sagt Schwester Pauline Ncabira. „Aber wir geben unser Bestes.“
Auch Teresia macht Fortschritte. Bevor sie wieder zurück in den Unterricht gehen muss, kann sie bei ihrer Großmutter noch einen Happen essen. Eine Banane. Teresia legt sie vor sich in den Schoß. Sie schält sie mühelos mit einer Hand.