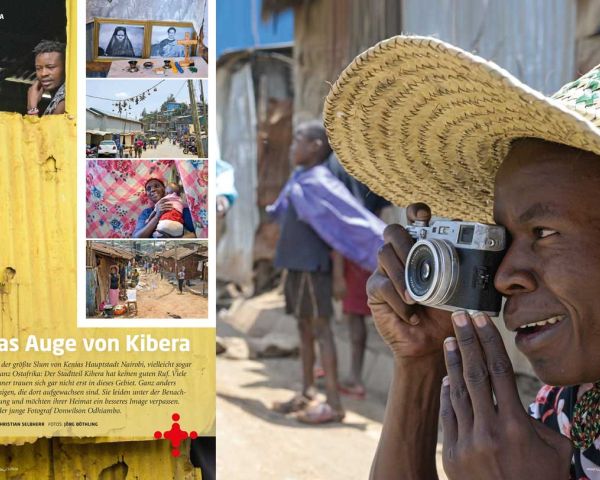„Wir gehören auch hierher“: Maronitische Gemeinde nach dem Gottesdienst mit Erzbischof Hanna Rahmé.Glockenläuten, Händeschütteln. Auf der Baustelle im Dorf Haouch Tall Safiyeh haben sich an diesem Sonntagmorgen besonders viele Gläubige versammelt. Nicht unbedingt, weil Erzbischof Hanna Rahmé heute den Gottesdienst in der kleinen, noch im Rohbau befindlichen maronitischen Kirche St. Jean Baptiste gefeiert hat. Das ist nicht außergewöhnlich, denn der 63-Jährige ist oft in den Dörfern unterwegs. Besonders ist aber, dass er heute im Anschluss an die Messe in den Gemeindesaal geladen hat. Erzbischof Rahmé möchte hören, wie es den Gemeindemitgliedern geht. Stühle werden herbeigeschafft. Rahmé blickt sich zufrieden um. In kleinen Schritten wird renoviert und gebaut. Schließlich ist der Raum ein wichtiger Treffpunkt für die Christen am Ort. Es gibt Kaffee und Saft, Frauen reichen Gebäck. Ein Mann fragt den Erzbischof scherzend, ob er Schulden machen musste, um alle einzuladen.
„Wir gehören auch hierher“: Maronitische Gemeinde nach dem Gottesdienst mit Erzbischof Hanna Rahmé.Glockenläuten, Händeschütteln. Auf der Baustelle im Dorf Haouch Tall Safiyeh haben sich an diesem Sonntagmorgen besonders viele Gläubige versammelt. Nicht unbedingt, weil Erzbischof Hanna Rahmé heute den Gottesdienst in der kleinen, noch im Rohbau befindlichen maronitischen Kirche St. Jean Baptiste gefeiert hat. Das ist nicht außergewöhnlich, denn der 63-Jährige ist oft in den Dörfern unterwegs. Besonders ist aber, dass er heute im Anschluss an die Messe in den Gemeindesaal geladen hat. Erzbischof Rahmé möchte hören, wie es den Gemeindemitgliedern geht. Stühle werden herbeigeschafft. Rahmé blickt sich zufrieden um. In kleinen Schritten wird renoviert und gebaut. Schließlich ist der Raum ein wichtiger Treffpunkt für die Christen am Ort. Es gibt Kaffee und Saft, Frauen reichen Gebäck. Ein Mann fragt den Erzbischof scherzend, ob er Schulden machen musste, um alle einzuladen.
Es ist Georges Karam (30). Er schüttelt Rahmé herzlich die Hand. „Sie wissen,wir alle ar�beiten hart“, sagt er. „Aber in Beirut interessiert sich niemand für uns. 15 Jahre lang war ich beim Militär und bekomme umgerechnet nur noch 50 Dollar im Monat. Wie soll das für eine Familie reichen?“ Die 26-jährige Mary-Lynn Nader ist mit Mann Walid und dem drei Monate alten Töchterchen Rhéa zum Treffen gekommen. Sie sorgt sich um die Zukunft ihrer kleinen Familie. Rhéa braucht eine erste Impfung. Aber die kostet 52 Dollar. Während der Woche arbeitet Walid in Beirut. Mary-Lynn ist mit dem Baby bei den Eltern im Dorf eingezogen. „Wir werden wieder hier leben“, erklärt sie. „Das ist billiger als in der Stadt.“
Explosion, Pandemie und Staatsbankrott
Erzbischof Hanna Rahmé kennt die Sorgen der Menschen in der Bekaa-Ebene. Und er kennt jede Familie beim Namen. Reich war die Region nie. Immer etwas vergessen von der Politik in der Hauptstadt. Doch erst ab 2020, mit den Folgen der zerstörerischen Explosion im Beiruter Hafen, der Pandemie und dem Bankrott des libanesischen Staates, kam die große Armut mit Wucht über die Bewohner. In dieser Zeit begann die Kirche damit, Lebensmittelpakete an bedürftige Familien zu verteilen. Anfangs waren es 50. Heute sind es 2500. „Und es werden immer mehr“, sagt Erzbischof Rahmé.
Christen, ihre Kirchen und Einrichtungen haben in der Bekaa-Ebene eine lange Geschichte. Wer sich vom Mittelmeer über das Libanongebirge in Richtung Syrien aufmacht, kann es nicht übersehen. Früher oder später passiert man an den Überlandstraßen eines der prägnaten Eisentore mit Kreuzstelen. Inzwischen hängt manches der vergoldeten Kreuze etwas lose im Wind. Fast schon ein Sinnbild für eine Gemeinschaft, die nicht mehr selbstverständlich ihren Platz einnimmt in einer Region, in der soziale Spannungen ein tolerantes Miteinander täglich mehr auf die Probe stellen. Ein gefährlicher Nährboden für Schubladendenken: Mehrheit oder Minderheit, Christ oder Muslim, Libanese oder Syrer.
Comeback für lukrative Feldfrucht: Der „Rote Libanese“
 Wie andere Gruppen auch bleiben die libanesischen Christen eher unter sichSeit dem Bürgerkrieg in den 1980er Jahren verlassen bis heute besonders viele Christen die Gegend. Gleichzeitig haben sich mehr und mehr Anhänger der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz niedergelassen. Auf den fruchtbaren Feldern, deren Ernte schon vor mehr als 2000 Jahren die Bewohner des Römischen Reiches ernährte, bauen die Menschen längst nicht mehr nur Wein, Kartoffeln oder Zwiebeln an. Die schlechten Zeiten haben einer lukrativeren Feldfrucht zu einem Comeback verholfen: Der „Rote Libanese“, seit den 1960er Jahren für lange Zeit ein Exportschlager auf dem weltweiten Haschischmarkt, knüpft wieder an seine alte Berühmtheit an. Wo keine staatliche Kontrolle, steigt die Erntemenge. Ein Indikator für die Krise und die Verzweiflung der Menschen auf der Suche nach einem Auskommen.
Wie andere Gruppen auch bleiben die libanesischen Christen eher unter sichSeit dem Bürgerkrieg in den 1980er Jahren verlassen bis heute besonders viele Christen die Gegend. Gleichzeitig haben sich mehr und mehr Anhänger der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz niedergelassen. Auf den fruchtbaren Feldern, deren Ernte schon vor mehr als 2000 Jahren die Bewohner des Römischen Reiches ernährte, bauen die Menschen längst nicht mehr nur Wein, Kartoffeln oder Zwiebeln an. Die schlechten Zeiten haben einer lukrativeren Feldfrucht zu einem Comeback verholfen: Der „Rote Libanese“, seit den 1960er Jahren für lange Zeit ein Exportschlager auf dem weltweiten Haschischmarkt, knüpft wieder an seine alte Berühmtheit an. Wo keine staatliche Kontrolle, steigt die Erntemenge. Ein Indikator für die Krise und die Verzweiflung der Menschen auf der Suche nach einem Auskommen.
Gleichzeitig wird es eng in der Bekaa-Ebene. Besonders auf dem informellen Arbeitsmarkt für Dienstleistungen in Handwerk und Landwirtschaft. Der Krieg im benachbarten Syrien hat bis zu einer halben Million Menschen dazu gezwungen, sich in Zeltstädten hinter der Grenze niederzulassen. Manche von ihnen leben seit mehr als zehn Jahren dort, ohne Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat.
Dazu kommen neue Geflüchtete: Seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel im Oktober verlassen täglich mehr Libanesen ihre Dörfer im Süden des Landes aus Angst vor den Kämpfen im Grenzgebiet. Im Zentrum dieser Gemengelage, gut 20 Kilometer nordwestlich der Hisbollah-Hochburg Baalbek, liegt das beschauliche Städtchen Deir el-Ahmar mit dem Amtssitz des Erzbischofs. Das Büro ist leer. Hanna Rahmé findet sich, wie fast jeden Tag, hinter dem Haus in seinem weitläufigen Garten. Hier baut er Tomaten an, Gurken und Kräuter. Er bestellt ein Weinfeld, ein Gewächshaus und hält Hühner. Rahmé will mit gutem Beispiel vorangehen: „In diesen Zeiten müssen wir uns zu�rückbesinnen und wieder selbst für uns sorgen“, sagt er.
Große Herausforderungen
 Familie Atallah ist froh über die Unterstützung der Kirche.Rahmé ist in der Bekaa-Ebene geboren und 2015 endgültig zurückgekehrt, um dem Erzbistum vorzustehen. Dass die Herausforderungen so groß würden, ja, dass auf ihn sogar einmal geschossen würde, damit hatte er nicht gerechnet. In seiner Tasche klingelt das Handy, wie so oft. Kaum einer, der inzwischen nicht die Mobilnummer des Erzbischofs hat. Dieses Mal ist es eine Familie aus der Nachbarschaft. Es geht um dringend benötigte Medikamente für ein Kind. Ob er nicht etwas tun könne. Immerhin, heute ist Kinder-Sprechstunde in der Klinik, die die Kirche über die Jahre in Deir el-Ahmar aufbaut. Rahmé ist froh, dass dieses Angebot zumindest bislang noch einmal die Woche möglich ist. Er hat gelernt, die kleinen Schritte zu schätzen.
Familie Atallah ist froh über die Unterstützung der Kirche.Rahmé ist in der Bekaa-Ebene geboren und 2015 endgültig zurückgekehrt, um dem Erzbistum vorzustehen. Dass die Herausforderungen so groß würden, ja, dass auf ihn sogar einmal geschossen würde, damit hatte er nicht gerechnet. In seiner Tasche klingelt das Handy, wie so oft. Kaum einer, der inzwischen nicht die Mobilnummer des Erzbischofs hat. Dieses Mal ist es eine Familie aus der Nachbarschaft. Es geht um dringend benötigte Medikamente für ein Kind. Ob er nicht etwas tun könne. Immerhin, heute ist Kinder-Sprechstunde in der Klinik, die die Kirche über die Jahre in Deir el-Ahmar aufbaut. Rahmé ist froh, dass dieses Angebot zumindest bislang noch einmal die Woche möglich ist. Er hat gelernt, die kleinen Schritte zu schätzen.
So wie Familie Sadaka. Was nicht bedeutet, dass man nicht träumen darf – zumindest bei der Namenswahl der Kinder. Byonce heißt die älteste Tochter. Nach einer der reichsten Musikerinnen der Welt. Vater Tony ist Mechaniker, Mutter Stéphanie im sechsten Monat schwanger und verdient in einer Molkerei ein wenig dazu. Mit Hilfe der Kirche haben die Sadakas auf einem kleinen Grundstück ein Haus gebaut. Aus den übrigen Ziegelsteinen hat Tony die Betten gebastelt. Endlich nicht mehr beim Vater auf dem Boden schlafen! Sorgen macht sich die Familie um die Schule für die vier Kinder. Keiner weiß, wie lange der Staat noch Geld für Bildung übrig hat. Schon jetzt fällt die Schule oft aus, da die Lehrer kaum noch Gehalt bekommen. „Wir wissen immer erst am Abend, ob der Tag gut war“, sagt Tony Sadaka. „Wir sind dankbar, dass die Kirche uns hilft. Aber es fühlt sich nicht gut an – ich möchte es doch selbst schaffen.“
Ein paar Häuser weiter lebt Familie Atallah in einem kleinen selbstgebauten Haus. Mutter, Vater und vier Kinder. Das Erzbistum half dabei, Milchpulver für die kleine July nach ihrer Geburt zu besorgen. Vater Elie arbeitet als Saisonarbeiter auf den Feldern – zusammen mit syrischen Geflüchteten. „Es ist nicht gerecht“, klagt er. „Die syrischen Familien bekommen von den UN Solarpanels, den Wasseranschluss und ihre Kinder Schulunterricht. All das können wir Libanesen uns in unserem eigenen Land nicht mehr leisten!“ Der Unmut sei vielerorts in Hass umgeschlagen, bestätigt der maronitische Ordensmann Boutros Akoury aus der Pfarrei Seriine bei einem Treffen mit dem Erzbischof. Libanesen berichteten, dass Syrer UN-finanzierte Solarmodule zum Verkauf anböten. Vor ein paar Wochen sei die Elektrik in der Kapelle gestohlen worden. Von wem? Das Misstrauen zwischen Libanesen und Syrern, auch zwischen Christen und Muslimen, wachse. „Immer mehr Bewohner fordern, dass die Syrer zurückgehen sollen.“
Das friedliche Miteinander stabilisieren
 Wir wissen erst am Abend, ob der Tag gut war“: Tony Sadaka mit seiner FamilieZurückgehen ist das Letzte, das Abed Lhamed aus dem syrischen Rakka vorhat. Der 33-Jährige steht mit einer Handvoll Männern zusammen, vor den UN-Zeltplanen einer der versprengten Geflüchteten-Siedlungen zwischen den Feldern von Deir el-Ahmar. Jahrelang kontrollierte der Islamische Staat seine Heimatstadt im Nordosten Syriens und terrorisierte die Menschen. Immer noch sind weite Teile der Stadt durch den Krieg zerstört. Islamisten operieren weiter aus den Geflüchteten-Camps heraus. „In Rakka ist es nicht sicher. Wir haben keinen Frieden in Syrien. Was sollen wir dort arbeiten? Als Saisonarbeiter waren wir auch schon vor dem Krieg im Libanon. Hier verdienen wir besseres Geld.“
Wir wissen erst am Abend, ob der Tag gut war“: Tony Sadaka mit seiner FamilieZurückgehen ist das Letzte, das Abed Lhamed aus dem syrischen Rakka vorhat. Der 33-Jährige steht mit einer Handvoll Männern zusammen, vor den UN-Zeltplanen einer der versprengten Geflüchteten-Siedlungen zwischen den Feldern von Deir el-Ahmar. Jahrelang kontrollierte der Islamische Staat seine Heimatstadt im Nordosten Syriens und terrorisierte die Menschen. Immer noch sind weite Teile der Stadt durch den Krieg zerstört. Islamisten operieren weiter aus den Geflüchteten-Camps heraus. „In Rakka ist es nicht sicher. Wir haben keinen Frieden in Syrien. Was sollen wir dort arbeiten? Als Saisonarbeiter waren wir auch schon vor dem Krieg im Libanon. Hier verdienen wir besseres Geld.“
In diesen schwierigen Zeiten – in denen kaum einer die freie Wahl hat – versucht die Kirche, das friedliche Miteinander in der Bekaa-Ebene zu stabilisieren. Darum muss es Platz und ein Auskommen für jeden geben. Ein Anfang ist zum Beispiel die kleine Siedlung in Yammouneh in einem Seitental. Auf den Berggipfeln liegt Schnee, unten im Tal blühen Apfel- und Mandelbäume. Ein einst christliches Dorf, das die Bewohner während der osmanischen Militärverwaltung ab 1915 verlassen haben. Im Zentrum steht noch die alte Kirche. Auf einem Feld am Ortsrand hat die Gemeinde nun angefangen an einer Zukunft zu bauen – immer, wenn wieder etwas Geld vorhanden ist. Die Mauern von fünf kleinen Häuschen stehen schon und ein kleiner Gemeindesaal, in dem immer wie�der Treffen mit den muslimischen Nachbarn stattfinden. Ein Platz für junge Familien, die sich das Leben in der Stadt nicht mehr leisten können. Die Äcker sind bereit, bestellt zu werden.